
Die Erhebung setzt sich aus verschiedenen Fragemodulen zusammen, welche Werte, Einstellungen und das soziale Verhalten der Bevölkerung in Europa messen. Der Fragebogen besteht aus einem fixen Kern aus sozio-politischen und sozio-ökonomischen Fragen und einem variablen Teil mit periodisch wiederkehrenden Schwerpunktthemen. Zudem werden experimentelle Testfragen und Fragen zum individuellen Wertesystem erhoben.
Die Schweiz hat bisher an allen Runden des ESS teilgenommen. Die Stichprobe besteht aus mindestens 1500 Personen ab 15 Jahren und ist repräsentativ für die in der Schweiz lebende Bevölkerung.
Der ESS hat zum Ziel:
- Eine breite Basis an qualitativ hochstehenden Daten zu schaffen, welche die Entstehung und Veränderung von Werten, Haltungen und Meinungen der Bürger in Europa dokumentieren.
- Stabilität und Wandel der gesellschaftlichen Struktur und der Lebensumstände aufzuzeigen und die politische, soziale und moralische Entwicklung in Europa zu erklären.
- Höhere Standards in der international vergleichenden Sozialforschung zu etablieren und weiterzuvermitteln, z.B. in der Fragebogenkonstruktion, den Pretests, der Stichprobenziehung und der Datenerhebung.
- Statistische Daten zum sozialen Wandel in den europäischen Gesellschaften besser sichtbar und zugänglich zu machen, dies sowohl für Vertreter aus Wissenschaft und Politik, wie auch für die Medien und Öffentlichkeit ganz allgemein.
Organisatorisch besteht der ESS aus einem zentralen Koordinations-Team (Core Scientific Team, CST), einer Methodengruppe und einem wissenschaftlichen Beirat. Die Schweiz wird in der Generalversammlung (General Assembly) durch Lea Bühlmann vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation vertreten.
Das zentrale Koordinations-Team ist für die Ausarbeitung der wissenschaftlichen Richtlinien verantwortlich. Es definiert die inhaltliche Ausgestaltung des englischen Fragebogens, die Wahl der Methoden und die Archivierung der Daten. Das Team wird seit Januar 2012 von Rory Fitzgerald geleitet. Es wird ergänzt durch Spezialistinnen und Spezialisten aus verschiedenen Partnerinstitutionen:
- Centerdata, Niederlande
- GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences, Deutschland
- Sikt – Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research, Norwegen
- Universitat Pompeu Fabra, Spanien
- University of Essex, England
Jedes teilnehmende Land führt die Erhebung gemäss den durch das zentrale Koordinations-Team etablierten methodischen Standards durch. In der Schweiz ist FORS für die Durchführung der Erhebung verantwortlich. Unter der wissenschaftlichen Leitung von Michèle Ernst Staehli plant und realisiert das ESS-Team von FORS sämtliche Phasen des Erhebungsprozesses: Es übersetzt den englischen Basisfragebogen in drei nationale Sprachen (Deutsch, Französisch und Italienisch), entwickelt die spezifischen Erhebungsmethoden und bereitet die Rohdaten so auf, dass sie von Forschenden und anderen Interessierten genutzt werden können.
Finanzierung
Die internationale Planung des Projekts, die Entwicklung des Fragebogens und die Archivierung der Daten wird von den Mitgliedsländern des ESS-ERIC getragen. Die Durchführung der Erhebung in der Schweiz hingegen wird seit Beginn der Studie im Jahre 2002 vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung (SNF) finanziert.
Die ESS-Erhebung zeichnet sich durch eine rigoros wissenschaftliche Vorgehensweise und hohe methodologische Ansprüche aus. Zwei Aspekte stehen dabei im Vordergrund:
Der Basisfragebogen muss mit besonderer Sorgfalt entwickelt werden, um länderübergreifende Vergleiche zu ermöglichen. Die Fragen werden in mehreren Ländern vorab getestet. Zudem wird grosser Wert auf die Qualität der Übersetzungen gelegt. Der ESS verfügt über ein methodologisches Team, das für den Übersetzungsprozess verantwortlich ist und die Richtlinien erstellt. Der Übersetzungsprozess folgt dem TRAPD-Ansatz (Translation, Review, Adjudication, Pre-testing and Documentation).
Die Qualität einer Befragung hängt in hohem Masse von den Verfahren zur Stichprobenziehung ab. Das zentrale Koordinations-Team des ESS wird aus diesem Grund durch Spezialistinnen und Spezialisten im Bereich der Stichprobenziehung ergänzt, welche die nationale Stichprobenziehung betreuen und kontrollieren. Damit die Stichprobe möglichst repräsentativ ausfällt, fordert der ESS eine strikte Zufallsstrichprobenziehung. In der Schweiz ist der ESS als Studie von nationaler Bedeutung anerkannt und die Stichproben dürfen seit dem Jahr 2010 aus dem Stichprobenrahmen für Personen- und Haushaltserhebungen (SRPH) des Bundesamtes für Statistik gezogen werden.
Um eine möglichst hohe Rücklaufquote zu erzielen, wird das methodische Vorgehen zudem laufend verbessert. Dazu gehört beispielsweise die intensive Schulung der Interviewer. Seit der dritten ESS-Runde werden in der Schweiz Rücklaufquoten von 40-50% erreicht, was für Schweizer Verhältnisse ein ausgezeichnetes Ergebnis darstellt.
Datengewinnung und Stichprobenverfahren in der Schweiz
Die Befragung richtet sich an die gesamte Wohnbevölkerung der Schweiz ab 15 Jahren. Um repräsentative Aussagen zur Schweiz zu gewinnen, werden die an der ESS-Befragung teilnehmenden Personen in einem strikten Zufallsverfahren ausgewählt. Die Stichprobe soll netto mindestens 1ʼ500 befragte Personen enthalten.
Da die Studie von nationaler Bedeutung ist, dürfen die Stichproben seit dem Jahr 2010 aus dem Stichprobenrahmen für Personen- und Haushaltserhebungen (SRPH) des Bundesamtes für Statistik gezogen werden. Die Verordnung über die Durchführung von statistischen Erhebungen des Bundes (vom 30. Juni 1993, Art. 13c, Abs.2, Bst. d. ) regelt, wie die Angaben dieses Registers vom ESS genutzt werden dürfen.
Stichprobenziehung:
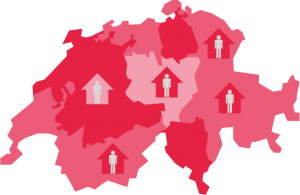
- Stichprobe einer bestimmten Anzahl Haushalte in allen Grossregionen der Schweiz (nationale Telefon- und Adressdatenbank)
- Zufällige Bestimmung einer Person in jedem Haushalt oder jeder Adresse

- Stichprobe der Postleitzahlen, gezogen in jeder Schweizer Grossregion
- Auswahl einer bestimmten Anzahl Haushalte/Adressen pro gezogene Postleitzahl
- Auswahl einer Person innerhalb jedes Haushalts/jeder Adresse
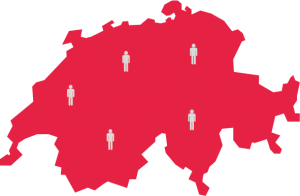
Bis zur ESS-Runde 11 erfolgte die Datenerhebung mittels persönlicher Interviews (CAPI). Ab Runde 12 findet ein schrittweiser Übergang zu selbstadministrierten Web- und Papierbefragungen (CAWI) statt. In Runde 12 wird die Hälfte der Stichprobe persönlich befragt (CAPI), während die andere Hälfte den Fragebogen online bzw. auf Papier ausfüllt. Ab der Runde 13 werden die Daten ausschliesslich im selbstadministrierten Modus erhoben. Die Befragung dauert etwa eine Stunde.
Der Fragebogen ist in zwei Hauptteile gegliedert: Er besteht aus einem zentralen Kern, der von Erhebung zu Erhebung unverändert bleibt und einem zweiten variablen Teil, der zwei oder mehrere Module zu bestimmten Themen beinhaltet, die periodisch wiederholt werden.
Die Kernmodule haben zum Ziel, die Evolution einer breiten Palette von sozialen Indikatoren aufzuzeigen. Dazu gehören die Mediennutzung, das Vertrauen in das soziale Umfeld, politische Partizipation und die Einschätzung von Institutionen, das subjektive Wohlbefinden, Empfindungen gegenüber Diskriminierung, Einstellungen zu Ausgrenzung sowie nationale, ethnische und religiöse Identität. Die Kernmodule erfassen auch Informationen zum soziodemografischen Profil der Befragten. Die Wiederholung dieser Fragen ermöglicht es, Veränderungen im Laufe der Zeit zu analysieren.
Die Wechselmodule des ESS variieren von Runde zu Runde. Forscherteams schlagen Module zu spezifischen Schwerpunktthemen vor, die entweder völlig neu sind oder bereits in früheren Jahren erhoben wurden. Ziel der rotierenden Module ist es, bestimmte Themen oder Forschungsfelder zu vertiefen oder zu erweitern. Beide Wechselmodule für den ESS 2025 (persönliches und soziales Wohlbefinden sowie Einstellungen zur Immigration) sind Wiederholungen früherer Ausgaben.
In den Zusatzmodulen werden experimentelle Testfragen und Fragen zum individuellen Wertesystem erhoben.
Erhebungswellen
| 2025 | Kernmodule A) Medien, Soziales Vertrauen, Politik, Subjektives Wohlgefühl, Sozialer Ausschluss, Religion B) Demographie | Wechselmodule C) Persönliches und soziales Wohlbefinden D) Einstellungen zu Immigration | Zusatzmodule E) Werte Testfragen |
| 2023 | Kernmodule A) Medien, Soziales Vertrauen B) Politik C) Subjektives Wohlgefühl, Sozialer Ausschluss, Religion F) Demographie | Wechselmodule D) Gesundheitliche Ungleichheiten E) Identität und Geschlechterrollen | Zusatzmodule H) Werte Testfragen |
| 2020/21 | Kernmodule A) Medien, Soziales Vertrauen B) Politik C) Subjektives Wohlgefühl, Sozialer Ausschluss, Religion F) Demographie | Wechselmodule D) Verständnis und Beurteilung der Demokratie G) Digitale soziale Kontakte in Beruf und Familie | Zusatzmodule H) Werte Testfragen K) Einstellungen zur Covid-19-Pandemie |
| 2018 | Kernmodule A) Medien, Soziales Vertrauen B) Politik C) Subjektives Wohlgefühl, Sozialer Ausschluss, Religion F) Demographie | Wechselmodule D) Lebensetappen G) Gerechtigkeit und Fairness | Zusatzmodule H) Werte Testfragen |
| 2016 | Kernmodule A) Medien, Soziales Vertrauen B) Politik C) Subjektives Wohlgefühl, Sozialer Ausschluss, Religion F) Demographie | Wechselmodule D) Solidarität und Wohlfahrtsstaat E) Einstellungen zum Klimawandel | Zusatzmodule G) Werte Testfragen |
| 2014 | Kernmodule A) Medien, Soziales Vertrauen B) Politik C) Subjektives Wohlgefühl, Sozialer Ausschluss, Religion F) Demographie | Wechselmodule D) Gesundheitliche Ungleichheiten E) Einstellungen zu Immigration | Zusatzmodule G) Werte Testfragen |
| 2012 | Kernmodule A) Medien, Soziales Vertrauen B) Politik C) Subjektives Wohlgefühl, Sozialer Ausschluss, Religion F) Demographie | Wechselmodule D) Persönliches und soziales Wohlbefinden E) Verständnis und Beurteilung der Demokratie | Zusatzmodule G) Werte Testfragen |
| 2010 | Kernmodule A) Medien, Soziales Vertrauen B) Politik C) Subjektives Wohlgefühl, Sozialer Ausschluss, Religion F) Demographie | Wechselmodule D) Polizei und Justiz E) Verhältnis Arbeit und Familie | Zusatzmodule G) Werte Testfragen |
| 2008 | Kernmodule A) Medien, Soziales Vertrauen B) Politik C) Subjektives Wohlgefühl, Sozialer Ausschluss, Religion F) Demographie | Wechselmodule D) Solidarität und Wohlfahrtsstaat E) Einstellungen gegenüber Altersgruppen | Zusatzmodule G) Werte Testfragen |
| 2006 | Kernmodule A) Medien, Soziales Vertrauen B) Politik C) Subjektives Wohlgefühl, Sozialer Ausschluss, Religion F) Demographie | Wechselmodule D) Vorstellungen zu verschiedenen Lebensetappen E) Persönliches und soziales Wohlbefinden | Zusatzmodule G) Werte Testfragen |
| 2004 | Kernmodule A) Medien, Soziales Vertrauen B) Politik C) Subjektives Wohlgefühl, Sozialer Ausschluss, Religion F) Demographie | Wechselmodule D) Gesundheit und Pflege E) Moralvorstellungen im Bereich Wirtschaft G) Verhältnis Arbeit und Familie | Zusatzmodule H) Werte Testfragen |
| 2002 | Kernmodule A) Soziales Vertrauen B) Politik C) Subjektives Wohlgefühl, Sozialer Ausschluss, Religion F) Demographie | Wechselmodule D) Einstellungen zu Immigration E) Soziales Engagement | Zusatzmodule G) Werte Testfragen |
ESS_2018_Questionnaire_English_French_German_Italian
ESS_2014_Questionnaire_English_French_German_Italian
ESS_2012_Questionnaire_English_French_German_Italian
ESS_2010_Questionnaire_English_French_German_Italian
ESS_2008_English_Source_Questionnaire
ESS_2008_Questionnaire_French_German_Italian
ESS_2006_English_Source_Questionnaire
ESS_2006_Questionnaire_French_German_Italian
Der ESS führt eine Liste der wissenschaftlichen Publikationen, die mit Daten aus dem ESS erstellt wurden.
Nach jeder Erhebungsrunde erstellt der ESS zudem eine thematische Broschüre mit den wichtigsten Resultaten und Ländervergleichen:
ESS 2018: Hauptresultate zu Gerechtigkeit und Fairness in Europa und zu den Lebensetappen
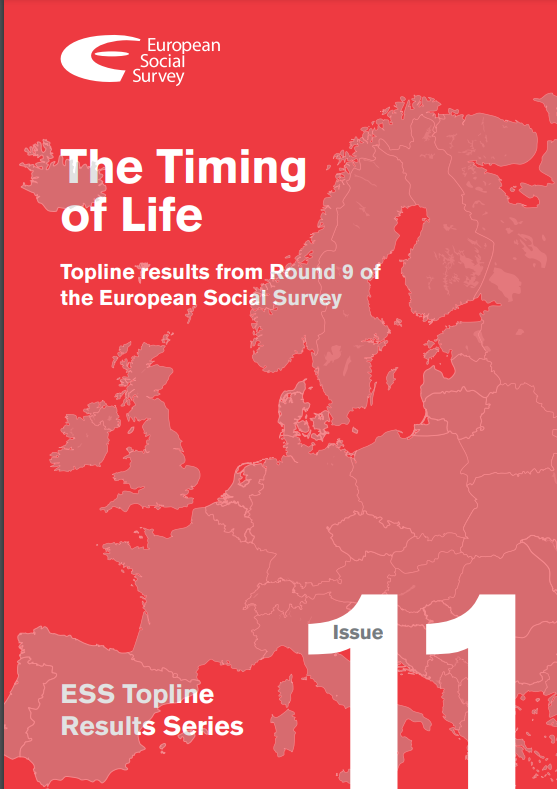
Einstellungen zum Thema Klimawandel und Energie in Europa (auch erhältlich auf Englisch und Französisch)
ESS 2014: Hauptresultate zu sozialen Ungleichheiten in Bezug auf die Gesundheit sowie zu Einstellungen gegenüber Immigration
Einstellungen gegenüber Immigration und ihre Ursprünge (auch erhältlich auf Englisch)
ESS 2012: Hauptresultate zu persönlichem und sozialem Wohlbefinden und zum Verständnis und der Beurteilung von Demokratie
Europeans’ Personal and Social Wellbeing (auch erhältlich auf Französisch und Italienisch)
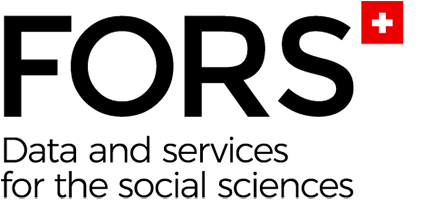
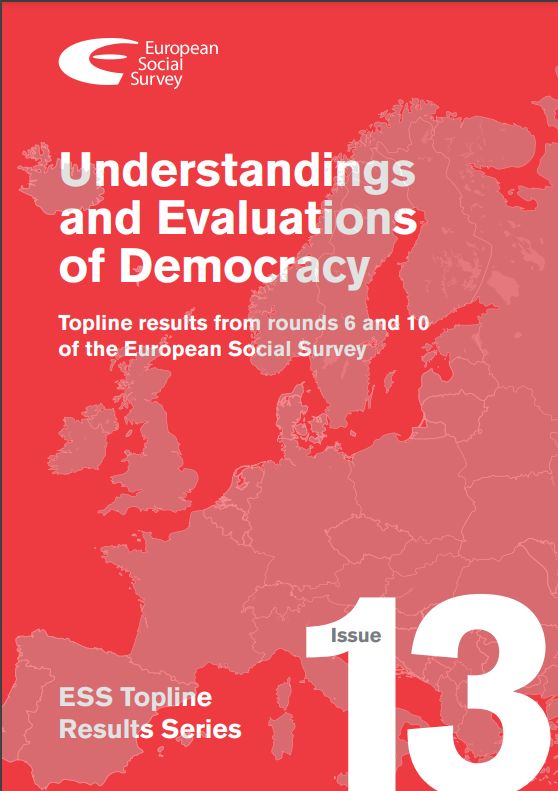
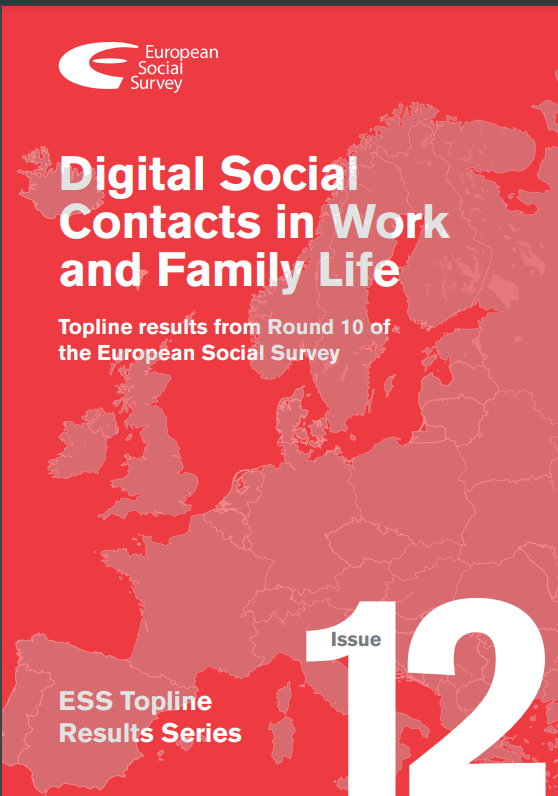

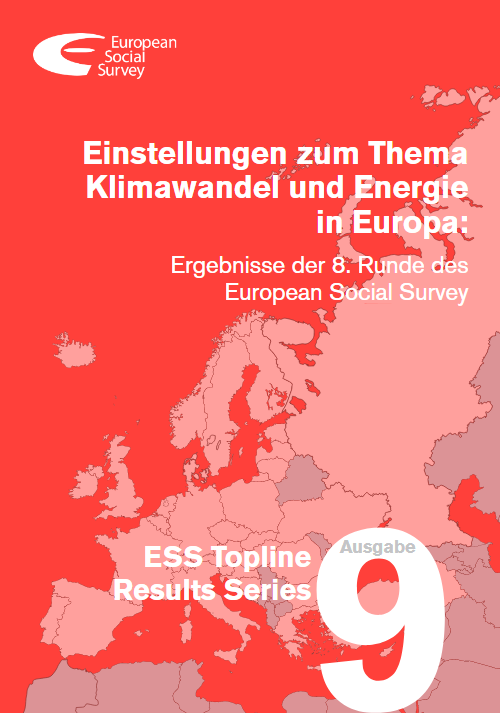
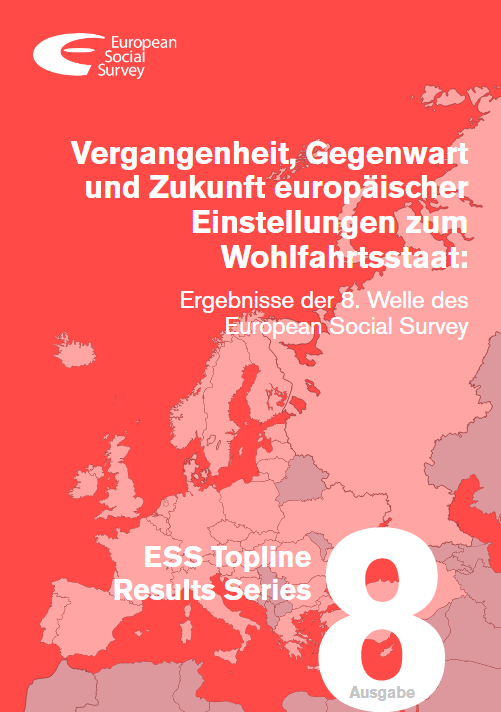
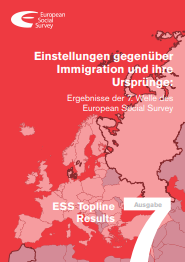

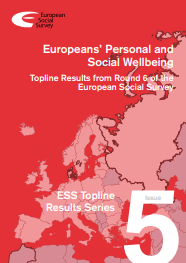
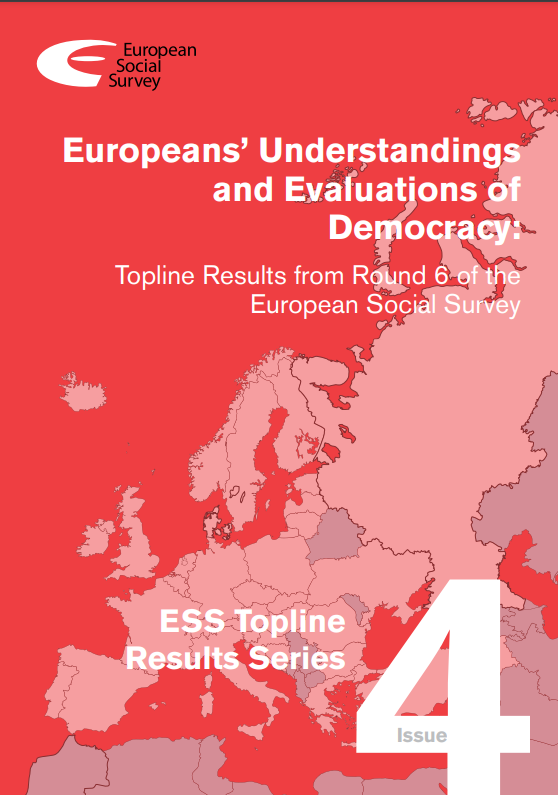
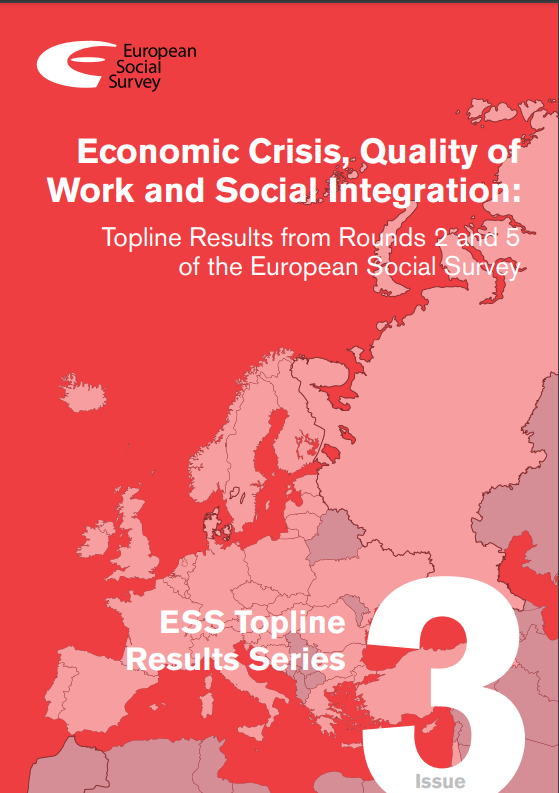
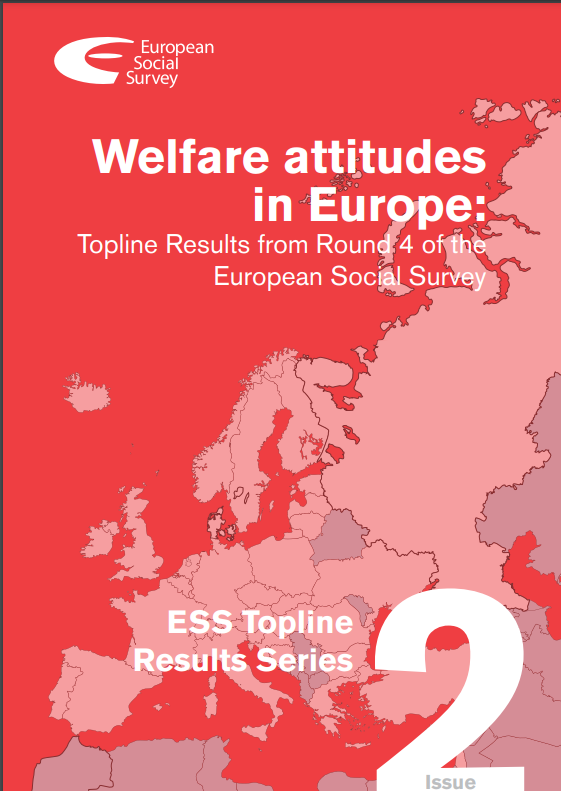
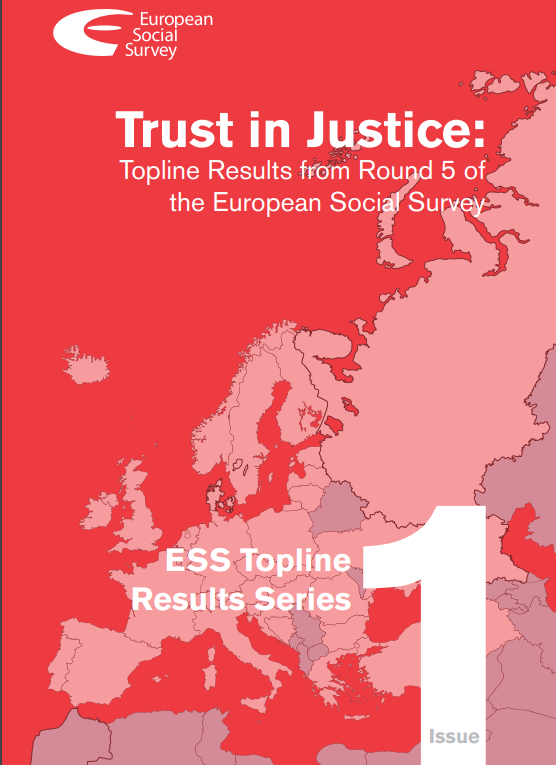



 +41 (0)21 692 37 30
+41 (0)21 692 37 30

